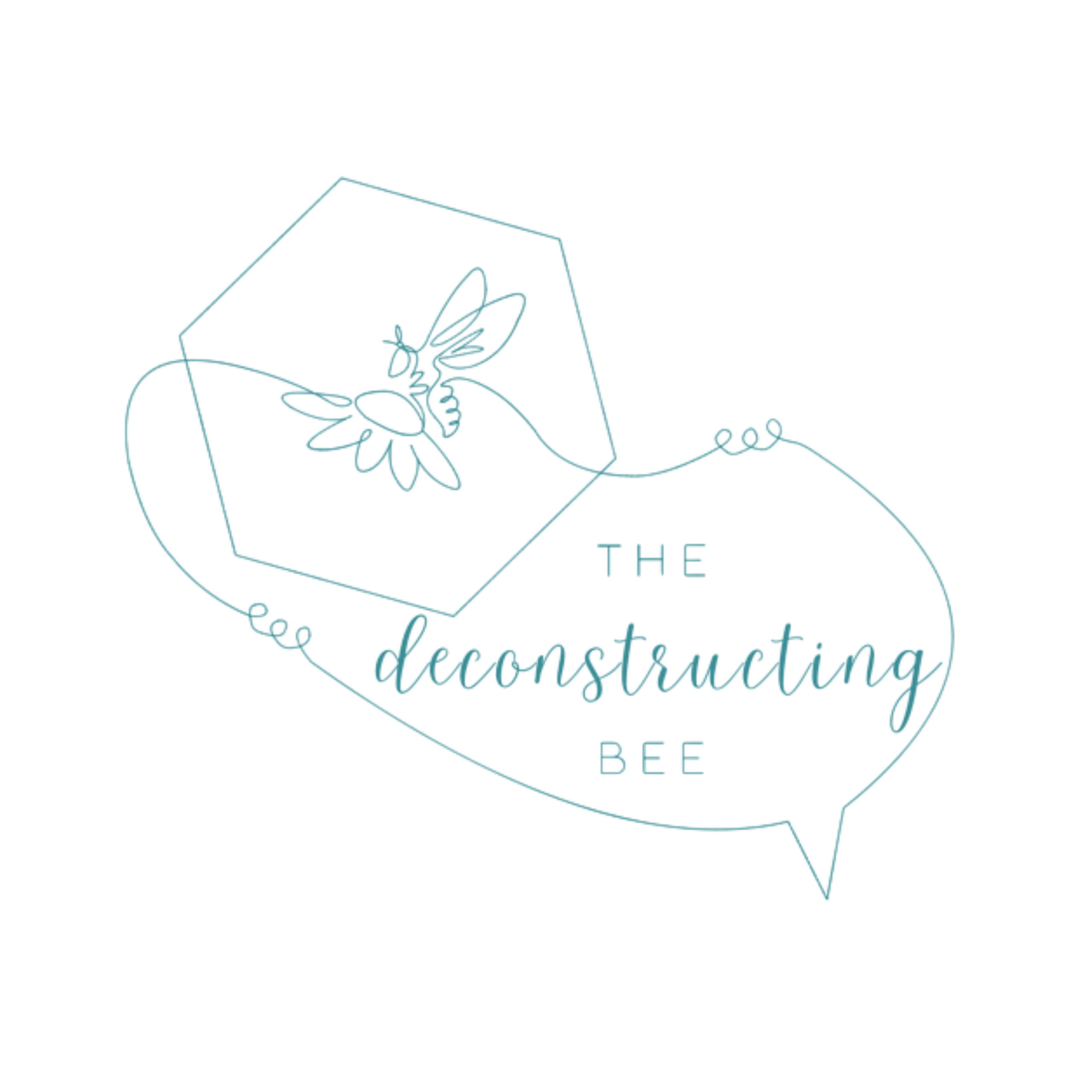Inhalt
ToggleInhaltswarnung: Dieser Post beinhaltet Schilderungen, die das Thema Depression streifen.
In Short
-
Deinen Glauben auf existenzieller Ebene zu hinterfragen ist sehr schmerzhaft.
-
Wenn du dir klar machst, was du in einem Gott alles zu haben glaubst, wird das verständlich.
-
Dennoch ist Dekonstruktion nicht dein Feind, sondern dein Lösungsversuch.
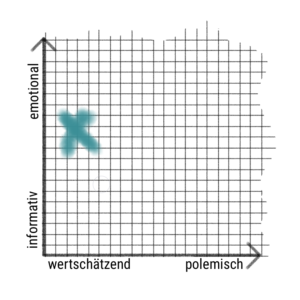
Vor etwa einem Jahr war ich wegen Depressionen in einer Klinik. In einer Therapiesitzung kurz nach Ostern problematisierte ich (zunächst sehr zögerlich) meine geistliche Prägung. Danach war ich super aufgewühlt.
Ich ging in den Essenssaal, wärmte mir eine Tasse Milch in der Mikrowelle auf und setzte mich zu zwei Mitpatientinnen. Wie in einer Art Übersprungshandlung nahm ich einen Schoko-Osterhasen von meinem Platz, packte ihn aus, tunkte ihn in meine Milch und sah ihm beim Schmelzen zu.
Als ich den beiden anderen von meiner Therapieeinheit erzählte, scherzte die eine, dass meine Identität gerade genauso dahinschmilzt wie der Schoko-Hase in meiner Milch. Und tatsächlich fühlte sich das so an.
Spätestens in diesem Moment begann mein Dekonstruktionsprozess.
Die schmerzhafte Seite
Mein Blog klingt an vielen Stellen ziemlich kritisch – und dazu stehe ich auch. Ich halte manche Gottesvorstellungen und einige der Gott zugeschriebenen Eigenschaften für äußerst fragwürdig und nicht überzeugend. Aus meiner aktuellen Perspektive erscheint mir der christlichen Glauben nicht mehr als die plausibleste Erklärung der Welt. Aber bei den Beiträgen, die sich eher darum drehen, meine Probleme mit dem Glaubenssystem aufzuzeigen, entsteht leicht die Illusion, ich hätte durch die Dekonstruktion nur total viel Freiheit erlangt. Das wäre aber nur dem von mir geschaffenen Einblick in den Prozess zuzuschreiben.
Es kommt immer darauf an, wie man Dinge framt: Ich liebe es, auf der logischen Ebene über Prozesse, Voraussetzungen und Erklärungen nachzudenken. Ich habe Freude am Fragen stellen und genieße es, nicht mehr auf spezifische Antworten festgefahren zu sein. Die intellektuelle Freiheit ist aber phasenweise der einzige Pluspunkt meiner Dekonstruktion. Klar, das erlebt jeder ganz anders, aber ehrlich gesagt habe ich sehr viel verloren, was mich maßgeblich ausgemacht hat. Es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, meinen Glauben zu verlieren. (Wenn du lieber Gedichte als Fließtexte liest, kannst du gern hier ein paar meiner Gedichte zu dem Thema lesen)
Die Trauer um Gott
Die Emotionen dabei, Gott zu verlieren, sind ein bisschen wie die eines Trauerprozesses nach dem Tod einer geliebten Person. (Natürlich hinkt der Vergleich an einigen Stellen – denn je nach Denkvoraussetzungen verliert man einmal jemand echtes und einmal nur eine sehr mächtige Idee, aber auf der emotionalen Ebene ist es vielleicht ein bisschen ähnlich – vergebt mir, wenn ich hier Äpfeln mit Birnen vergleiche oder irgendwas bagatellisiere, das ist nicht meine Absicht.)
In dem Vergleich mit dem Trauerprozess gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied: So trist das auch klingen mag: Die eine Sache, der sich jeder Mensch sicher sein kann, ist, dass er irgendwann sterben wird. Endlichkeit ist Teil des Menschseins. In einer fortschrittlichen Gesellschaft, in der medizinische Errungenschaften den Tod immer weiter nach hinten verschieben, steht der Tod zwar nicht mehr so auf der Tagesordnung wie in vergangenen Zeiten – aber dass wir sterbliche Wesen sind, kommt nicht als Überraschung.
Anders ist es bei dem Gott, der außerhalb der Zeit ist: Schon allein diese Eigenschaft macht Gott eigentlichen unverlierbar. Gerade angesichts der Konfrontation mit der Fragilität des Leben ist Gott als sichere Grundkonstante im Leben sehr wertvoll. Gott dann doch zu verlieren ist damit der Verlust einer Grundkonstante, deren Wegbrechen man für unmöglich gehalten hatte.
Aber Gott ist viel mehr als „nur“ eine bleibende Sicherheit: Er ist das Gegenüber, auf das man in jeglichen Lebenssituationen zurückgegreift: Er ist Adressat von Bitte und Dank, bei ihm darf man alle Sorgen und Emotionen ablegen. Gewissermaßen projiziert man alle positiven Eigenschaften, die man sich bei Menschen wünscht, auf diese Entität. Von ihm weiß man sich völlig gesehen, gekannt und geliebt. Das kann (und muss) kein Mensch leisten. Auch hier spielt die übernatürliche Dimension Gottes eine große Rolle: Selbst die Personen, die dir am nächsten stehen, werden nie alles mit dir miterleben. Gott ist immer dabei: Mehr noch: Er sieht auch deine Welt mit durch deine Augen; Es kann nicht zu Missverständnissen seinerseits kommen: Du musst dich nicht erklären, Gott kennt und versteht deine Gedanken und Perspektiven.
Depression & Dekonstruktion
Als ich meinen Glauben verloren habe, habe ich die wichtigste Person in meinem Leben verloren. Und diese Person hinterlässt nicht nur in meinem Leben, sondern auch in meiner Identität ein riesiges Loch. So war Dekonstruktion für mich lange etwas von Grund auf Schlechtes – ich wollte meinen Glauben nicht auf diesem existenziellen Level hinterfragen. Fragen über irgendwelche christlichen Lehren zu stellen, ist die eine Sache; die andere sind die tiefgreifenden Zweifel an der Existenz Gottes, dieses Lebensgebers und Retters.
Wie bereits angedeutet, ging Dekonstruktion bei mir mit einer Depression einher. Dabei ist es mir wichtig, zu erwähnen, dass in meinem Fall die Depression zuerst da war. Die Fragen, die man sich in einem Dekonstruktionsprozess stellt, waren mir nicht neu – aber in dieser schlimmen Zeit kamen zu meinen intellektuellen Fragen, die mich zwar immer schon bewegt, aber bisher nicht erschüttert hatten, emotionale Fragen hinzu. Die kognitive Dissonanz zwischen meinem depressiven Erleben und dem, was ich über Gott wusste, war unüberwindbar.
Ich war emotional taub: In meinen zwischenmenschlichen Beziehungen habe ich keine Nähe mehr spüren können – das galt auch für meine Empfindungen gegenüber Gott. Ich konnte nachvollziehen, wie meine Erkrankung meine Empfindungen bezüglich meiner Mitmenschen beeinflussen. Aber ich konnte nicht verstehen, wieso sich Hirnchemie in meine Gottesbeziehung einmischen durfte. Mein verzweifeltes Eingeständnis „Gott ist weg“ war schlimmer als jedes andere depressive Symptom.
Aber das war natürlich erst der Anfang vom Ende. Es vergingen noch einige Monate, bis ich feststellte, dass ich überhaupt nicht mehr glaubte. In diesem Prozess war ich mehr wie das verlorene Schaf als wie der verlorene Sohn, um in biblischen Bildern zu sprechen. Ich wollte nicht von Gott weg. Ich habe ihn umherirrend gesucht. Mit aller Kraft versuchte ich, mich an Jesus, dem Glauben, irgendetwas festzuklammern. Aber irgendwann merkte ich, dass ich nichts mehr in den Händen hielt.
Deine Psyche meint es gut mit dir!
Seitdem ist glücklicherweise viel passiert. Unter anderem habe ich gelernt, dass die Dekonstruktion nicht mein Feind ist. Es hat sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass die Dekonstruktion nicht noch ein weiteres Problem in meinem Leben ist – sie ist mein Lösungsversuch.
Meine Reaktion auf die Mischung aus biografischen Baustellen, Glaubensfragen und gesundheitlichen Problemen war nicht willkürlich. Dekonstruktion ist ein Versuch, die Dinge zu ordnen. Wenn man dekonstruiert, dann geschieht das nicht aus dem Nichts. Es gibt immer einen Grund, einen Auslöser, sei es auch nur ein Ungleichgewicht von verschiedenen Lebensbereichen, die nicht so recht zusammenpassen wollen. Der Prozess des Infragestellens und Sortierens ist eine Reaktion auf Umstände, die eine Anpassungsleistung fordern. Ich habe dazu mal eine interessante und hilfreiche Podcastfolge von „Schöner Glauben“ gehört, die Dekonstruktion anhand der Systemtheorie zu erklären versucht.
Es ist erleichternd, zu lernen, dass die menschliche Seele Sinn ergibt. Dass man es auf der tiefsten Ebene eigentlich gut mit sich selbst meint. Wenn es einen Gott gibt, war er derjenige, der unsere Psyche so gestaltet hat, dass sie uns Warnsignale schickt, wenn sie merkt: „Hier ist etwas falsch.“ Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann hat er uns diese Mechanismen geschenkt – es wäre unklug, sie zu ignorieren. Intuition ist wichtig.
Deine Psyche will etwas von dir, wenn du dich in einem Dekonstruktionsprozess wiederfindest. Es ist schmerzhaft, einsam und im Fall einer Dekonversion mit dem Gefühl verbunden, eigentlich nur zu verlieren. Das darf betrauert werden. Aber das macht den Prozess an sich nicht weniger notwendig.
Ich will dir Mut zusprechen – Als jemand, der Depression und Dekonstruktion zusammen erlebt hat, weiß ich, wie hoffnungslos und auswegslos es zwischenzeitlich aussehen kann. Aber da ist Licht am Ende des Tunnels. Für mich ist ein großer Schritt zur Besserung (in beiden Prozessen) gewesen, Dekonstruktion und Depression als Schmerz zu betrachten. Schmerz hat immer eine Warn- und/oder Schutzfunktion. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich bin die letzte, die jemandem mit einer Depression sagen würde: Dein Herz will dir was sagen – Deine Erkrankung hat einen Sinn. Es geht mir vielmehr darum, dass Depression (fast immer) die logische Folge verschiedener Lebensumstände und nur Symptom ist.
Dass Schmerz eine Funktion hat, macht ihn nicht cool. Depression ist Scheiße. Und Dekonstruktion machmal auch. Aber deine Dekonstruktion hat eine Funktion! Vielleicht kannst du, statt gegen sie, mit ihr zusammenarbeiten. Dafür musst du sie nichtmal sympatisch finden :)
Eine Achtsamkeitsübung, die dabei helfen kann, die Dekonstruktion weniger negativ zu betrachten, ist es, sie zu personifizieren. Stell dir deine Dekonstruktion als Mensch vor, der sich um dich sorgt und mit einem Anliegen zu dir kommt: Was will die Person dir sagen?
Jetzt bin ich gespannt: Was hilft dir dabei, dich mit deinem Prozess auszusöhnen?
Schreib es gern in die Kommentare!