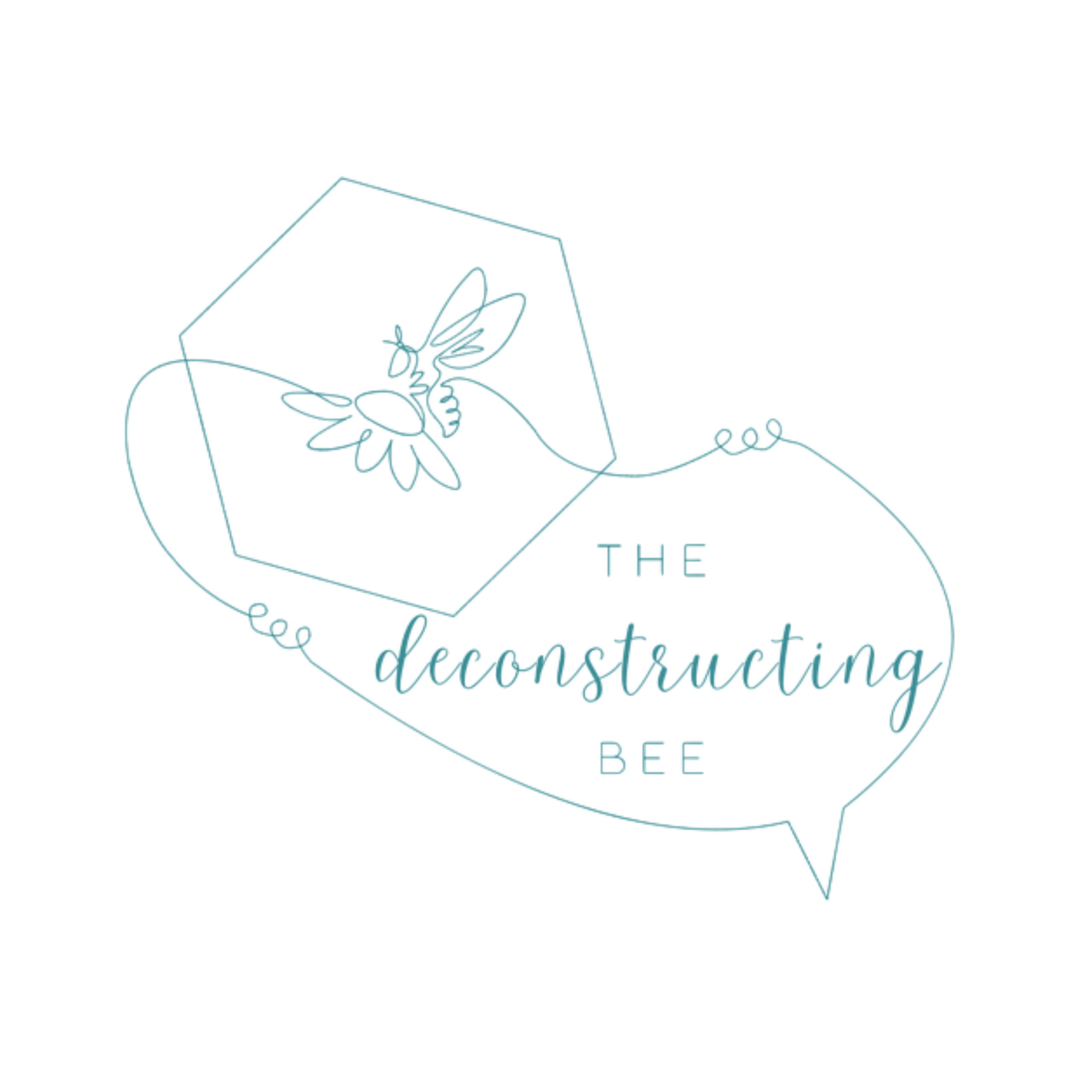Inhalt
ToggleIn Short
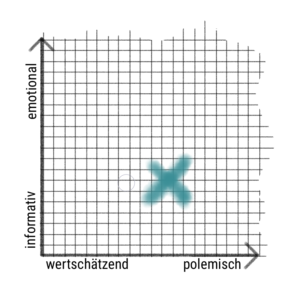
Als Christin hatte ich eine interessante Beziehung zum Thema Gebet. Besonders das Konzept der Fürbitte erweckte in mir zugleich Skepsis und Respekt. Auf der einen Seite hatte ich viele berechtigte Fragen zum Nutzen des Gebets, auf der anderen Seite bewunderte ich Menschen für ihre Gebetspraxis. Erfahrungsgemäß ist Gebet in evangelikalen Kreisen ein wirksames Mittel des „Virtue-Signaling“, also des Signalisierens des eigenen vorbildlichen Charakters. Wer viel betete, galt zumindest gefühlt als besonders heilig und als guter Christ. Diese unterschwellige Hierarchie hätte natürlich niemand laut ausgesprochen – immerhin sind Christen alle durch Jesus geheiligt –, aber praktisch gab es eine große Schnittmenge von besonders gebetsstarken und besonders bewunderten Menschen.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich diese soziale Hierarchie aufgrund von Gebetsfreudigkeit ziemlich faszinierend. Menschen werden dafür gefeiert, wie viel und mit welcher Intensität sie eine allwissende und souveräne höhere Macht um Dinge bitten. Heute bewundere ich noch immer die Beständigkeit, die viel betende Menschen unter Beweis stellen. Aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit, die schon früher in meinem Hinterkopf existierte, ist deutlich präsenter und dämpft den Großteil meiner ehemaligen Bewunderung. Aus meiner aktuellen Perspektive schafft jeder Erklärungsversuch der Notwendigkeit und Wirksamkeit von Gebet mehr Probleme, als er löst.
Dabei eines vorweg: Wahrscheinlich werfen mir ChristInnen vor, dass die Frage bereits auf einer falschen Prämisse beruht: Effizienz ist kein Maßstab, den man an eine Beziehung anlegen sollte. Und Gebet soll Gottesbeziehung sein. Deshalb hier die Einschränkung: Es geht hier nicht um die Gebete, in denen ChristInnen Gott von ihrem Tag erzählen, sich ausheulen oder bedanken. Hier geht es spezifischer um Fürbitte: Also jegliches Gebet, dass Gott auf irgendeine Weise um das Eingreifen in eine Situation bittet.
Funktioniert Gebet?
Vor einer Weile erzählte mir jemand von einer Studie, die belegen würde, dass Gebet bei Krankheit tatsächlich statistisch nachweisbar zu besseren Heilungschancen führen könnte. Das war einer der Momente, in denen ich mich darüber gefreut habe, in einer Zeit zu leben, in der ich diese Aussage fact-checken kann. Ich begab mich also ein bisschen in die Ecke des Internets, die sich mit solchen Studien beschäftigte, und kam zu folgendem Ergebnis: Es gibt keine Studie, die statistisch signifikante Heilungsunterschiede bei Menschen mit und ohne Fürbitte nachweisen konnte. Stattdessen gibt es sogar eine Studie, die bei denjenigen, die vor einer OP wussten, dass für sie gebetet werden würde, mehr Komplikationen feststellen konnte.
Das Dilemma der Nachweisbarkeit
Aus christlicher Perspektive lässt sich leicht argumentieren, dass mit einem statistischen Nachweis der Glaubensaspekt wegfallen würde: Wenn man wüsste, dass es funktioniere, müsste man nicht mehr vertrauen. Dann wäre Gott wie ein Automat, in den man Gebet einwerfe. Heraus käme dann die erbetene Lösung.
Aus atheistischer Perspektive wiederum lässt sich argumentieren, dass Gebet keinen Unterschied macht, wenn es nicht statistisch belegbar ist und somit hinsichtlich der Veränderung der Situation sinnlos ist.
Dagegen kann gehalten werden, dass man Erhörung von Gebet nicht mit Erhalten des Gewünschten gleichsetzen kann. Schließlich habe Gott einen viel weitläufigeren Blick als der kleine Mensch. Demnach kann der Christ behaupten, dass Gott jedes Gebet erhört, nur eben nicht immer auf die vorgestellte Art und Weise.
Der Zirkelschluss vorausgesetzter Gebetserhörungen
Die möglichen Antworten Gottes auf Gebet umfassen also meist alle erdenklichen Optionen:
a) Ja
b) Noch nicht
c) Nein
Das schützt das Statement „Gott erhört Gebet“ vor jeder Anfrage. Da nicht definiert wird, wie eine Gebetserhörung auszusehen hat, gibt es keine Möglichkeit, die Position zu widerlegen. Es bleibt kein negatives Ergebnis mehr übrig, wenn alle Antworten als Gottes Antworten verstanden werden. Damit enthebt sich Gebetserhörung aller Falsifizierbarkeit und damit auch der Verifizierbarkeit.
Gottes (fehlendes) Handeln: theologische Konsequenzen
Gottes Verhältnis zu Gebet habe ich hier in drei Möglichkeiten kategorisiert: Entweder er reagiert überhaupt nicht, er hat seine Reaktionen eingeplant oder er reagiert wirklich auf manche Gebete, sodass sie so „funktionieren“, wie die Beter es sich wünschen. Jede dieser Positionen bringt Folgeprobleme mit sich, die bestimmten christlichen Lehren einen Strich durch die Rechnung machen. Falls Dir noch eine vierte Position einfällt, schreib sie mir gern in die Kommentare!
1. Kein Einfluss: Gott reagiert nicht
Der größte Vorteil dieser Position ist, dass immerhin der Heilsplan gesichert ist: Denn wenn Gott in der Bibel zuverlässige Vorhersagen machen möchte, muss sein Plan von der Zukunft fest sein. Nur so kann sein Plan aufgehen. Wenn nun Gebet Gottes Willen verändern würde, könnten diese Vorhersagen damit nicht mehr garanntiert eintreffen.
Problematisch daran ist jedoch, dass es praktisch keine interaktive Beziehung von Gott und Mensch geben würde. Wenn Gebet also Gottes Willen nicht verändern kann und er nicht in die Welt eingreift, ist Fürbitte sinnlos.
Natürlich könnte Gebet immer noch eine Art reflexiven Mehrwert haben, aber die Gottesbeziehung würde eher auf einen moralisch-therapeutischen-Deismus hinauslaufen. Das würde dazu führen, so manche Bibelgeschichte infrage zu stellen und neu interpretieren zu müssen. Praktisch überall, wo gebetet wird und Gott scheinbar reagiert, müsste eine neue Lesart her.
2. Eingeplante Gebetserhörungen
Die zweite Möglichkeit, die ebenfalls Gottes souveränen Plan sichert, ist, dass er Gebet und Reaktion mit eventueller Umstimmung eingeplant hat. Das ist mindestens einmal ein komisches System, aber die Position würde am ehesten funktionieren. Denn sie behält die Bedeutung von Fürbitte bei, ohne dabei die Frage nach der Sinnhaftigkeit zu ignorieren. Das größte Problem dabei ist, dass damit nicht die Gebete selbst wirksam sind, sondern letztendlich Gottes Plan. Gebete wären dann einfach nur Teil eines ablaufenden Skripts, was zu erheblichen Schwierigkeiten führt, wenn man an einem sinnigen Konzept des freien Willens festzuhalten möchte. Damit wird die Frage nach der Wirksamkeit zwar oberflächlich behandelt, aber die zugrundeliegende Unstimmigkeit nicht wirklich erklärt.
3. Gottes Eingreifen und dessen Konsequenzen
Denn es ist eine krasse kognitive Dissonanz, an einen allmächtigen und allwissenden aber trotzdem irgendwie reaktionären Gott zu glauben.
Die größten Folgeprobleme sind meines Erachtens diese:
Ungerechtigkeit
Freier Wille
Außerdem ergibt sich aus erhörtem Gebet ein Problem für den freien Willen der Menschen. Wenn jemand beispielsweise für Schutz betet und deshalb auf dem dunklen Heimweg nicht überfallen wird, muss Gott so eingegriffen haben, dass er den Willen des Angreifers verändert hat oder dem betenden den Einfall eines anderen Weges gegeben hat. In beiden Fällen wird der Wille wenigstens durch veränderte Rahmenbedingungen manipuliert. Wenn das hier okay ist, ist damit der Erklärungsansatz des freien Willen für das Theodizeeproblem geschwächt:
Häufig wird in Reaktion darauf, dass es so viel Böses auf der Welt gibt gesagt, dass die Menschen freie Entscheidungen treffen, die eben auch Leid zur Konsequenz haben. Sobald man nun aber an einen eingreifenden Gott glaubt, fällt damit die Möglichkeit weg, dass das Leid auf den freien Willen des Täters zurückgeführt werden kann und Gott damit fein raus ist. (Mit dem Theodizeeproblem werde ich mich an anderer Stelle auseinandersetzten. Natürlich gibt es eine vielzahl an Erklärungsansätzen – mir ist durchaus bewusst, dass mit diesem kleinen Kommentar zur „free-will-defence“ noch lange nicht alles gesagt ist.)
...Bedeutet?
Also, wie man es dreht und wendet: Die Bitten endlicher, fehlbarer Wesen können nicht problemlos auf das Handeln eines allwissenden, allmächtigen Wesens einwirken. Und wenn sie es nicht können, sind sie in ihrem primären Anliegen unwirksam. Die größten Hürden stellen Zukunftsgewissheit und freier Wille dar: Wenn Gott die Zukunft zuverlässig vorhersagen will, muss Gebet in sich wirkungslos sein. Damit Gott gewährleisen kann, dass alles so endet, wie es muss, gibt es mindestens auf Ebene der Weltgeschehnisse Gebete, auf die er auf nicht reagieren kann.
Auch gibt es Gebete, auf die er mit dem Einwirken auf freien Willen der betroffenen Akteure reagieren muss, wenn bestimmte Ziele erreicht werden sollen.
Verantwortung und Macht
Die Notwendigkeit der Bitte
Zusätzlich ist meiner Meinung nach die Notwendigkeit von Gebet das größte Problem. Was für ein Gott würde sich nur angesprochen fühlen, wenn man tatsächlich das richtigere Bild aus dem richtigen Buch abgeleitet hat?
Was ist das für ein Gott, der sich anbetteln lässt und die völlige Hilflosigkeit der Menschen, die sich an ihn wenden, überwiegend subjektiv unbeantwortet stehenlässt? Und wenn er tatsächlich Leid durch Gebet lindern sollte: Was für ein Gott würde das Leid eines Menschen sehen und es nur beenden, wenn er lieb gebeten wurde?
Wenn ich an einem ertrinkenden Kind vorbeilaufe und keine erste Hilfe leiste, weil es mich nicht um Hilfe gebeten hat, kann ich mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden. Ich als begrenzter Mensch werde dafür zur Rechenschaft gezogen, ein Gott mit allen Möglichkeiten aber nicht!? Wenn man darauf damit reagiert, dass Gott es eh besser weiß, sind wir wieder an dem Punkt, wo Gebet sinnlos ist.
Der Schmerz der Hoffnung
Hoffnung kann etwas Wunderschönes sein. Aber mit den Hoffnungen von Menschen zu spielen oder ihnen falsche Hoffnungen zu machen ist für die Betroffenen unglaublich schmerzhaft. Ein nicht zu vernachlässigender Teil von Gebet ist genau das. Die Bibel zeichnet ein sehr hoffnungsvolles Bild von Gebet:
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“(Lk 11,9)
Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr’s empfangt, so wird’s euch zuteilwerden.“ (Mk 11,24)
Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. (1 Joh 5,14f)