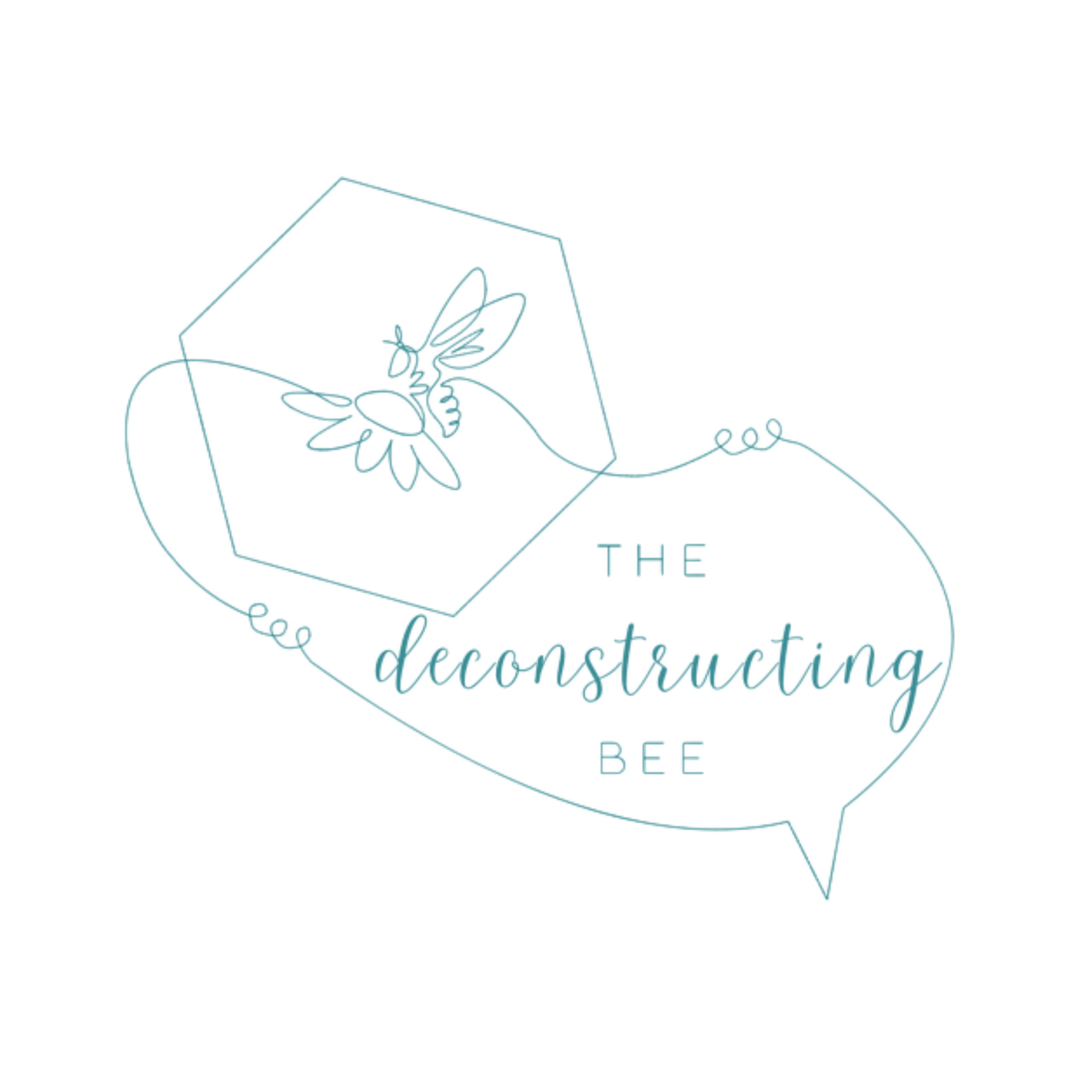Inhalt
ToggleIn Short
-
Ein Argument, dass mindestens auf emotionaler Ebene stark für den Glauben spricht, ist das der Begründung objektiver moralischer Werte.
-
Aber was bedeutet es, wenn man seine Ethik in Gott gründet?
-
Ethik ist komplex und unbequem - ich stelle den Utilitarismus vor [natürlich gäbe es noch viele andere Gegenmodelle, hier nur ein Beispiel]
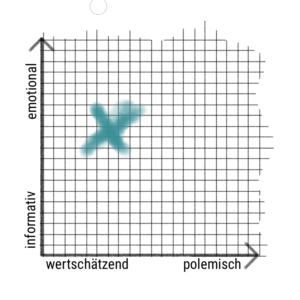
Der Anreiz christlicher Ethik
Als Christin hatte ich die Vorstellung, Atheisten hätten kein wirkliches Fundament für ihre Moral. Meine Werte waren mir immer sehr wichtig (liegt wohl in der Natur der Sache…) und ich hatte Angst, sie mit meinem Glauben zu verlieren. Oder sie nicht mehr begründen zu können. Das war vielleicht das Thought Terminating Cliché, mit dem ich mit am längsten herumgeschlagen habe.
Als die ethische Begründung: „Weil die Bibel es so sagt/impliziert/…“, wegfiel, war ich erstmal aufgeschmissen. Es ist schon cool, seine Position mit einer höheren Macht, der Gottesebenbildlichkeit u. Ä. begründen zu können. Stattdessen war ich jetzt darauf angewiesen, meine Ethik im Bewusstsein der Verantwortung für meine Entscheidung zu treffen. Es gab keine Gottheit mehr, die meine Taten, Gedanken oder Gefühle bewertete. Da war nur noch ich in meinem Kopf. Welchen Maßstab konnte ich jetzt anlegen? Ich war wirklich lost. Wahrscheinlich nicht zuletzt, weil ich so geprägt worden war, dass die Bibel als einzig wahre Grundlage für ethisches Verhalten und andere moralische Systeme als willkürlich oder unzureichend darstellt hatte.
Das moralische Argument für die Existenz Gottes
Und das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen: Das moralische Argument für die Existenz Gottes war immer das für mich überzeugendste Argument gewesen. Es lautet wie folgt:
P1: Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine objektiven moralischen Werte
P2: Es gibt objektive moralische Werte
K: Es gibt einen Gott.
Das Argument ist logisch folgerichtig aufgebaut – und auch die Prämissen lassen sich belegen. Um darzustellen, dass es objektiv richtige und falsche Taten gibt, wird häufig das Beispiel „Babys aus Spaß foltern“ angebracht. Wenn man sagt, dass das objektiv falsch ist, dann bestätigt man die Existenz objektiver Werte und damit die Existenz eines Gottes.
Dennoch stellt sich die Frage, ob ein Gott diese objektive Moral liefern würde:
Das Euthyphron-Dilemma
Das Euthyphron-Dilemma (benannt nach einem Dialog von Platon) bringt die Frage der objektiven Moral auf den Punkt:
„Ist etwas gut, weil Gott es befiehlt, oder befiehlt Gott es, weil es gut ist?“
Wenn etwas gut ist, weil Gott es befiehlt, wären moralische Werte willkürlich und könnten sich ändern, wenn Gott andere Befehle gibt. In diesem Fall wären moralische Werte abhängig von Gottes Willen und hätten keine unabhängige objektive Existenz.
Wenn Gott etwas befiehlt, weil es gut ist, dann existieren moralische Werte unabhängig von Gott. Dies bedeutet, dass es eine externe moralische Ordnung gibt, die auch Gott erkennen und befolgen muss. In diesem Fall wäre Gott nicht der Ursprung der objektiven Moralvorstellung.
Der (nicht so objektive) Standard
Theologen beantworten das Dilemma häufig damit, dass Gott gut ist und somit alles, was er gebietet, gut sein muss. Demnach wählen sie die erste These. [Damit ist Ethik aber genaugenommen nicht mehr objektiv: Auf gewisse Art und Weise ist eine Moralvorstellung, die Gott zwischenschaltet, subjektiv: Nur, dass Gott das Subjekt ist und nicht wir selbst. Aber dennoch ist der Standard transzendent und damit im übertragenen Sinne objektiv… Diese Art von Objektivität meine ich, wenn ich im Folgenden von der objektiven christlichen Ethik schreibe.] So kann man zu der Position kommen, dass Gott als Standard objektive, in seiner eigenen Güte basierende Werte begründet. Allerdings ist man damit 1.) noch nicht beim biblischen Gott gelandet und 2.) weit entfernt davon, eine praktische Grundlage in der Frage nach richtigen ethischen Entscheidungen zu haben.
Es stellen sich deshalb zwei Fragen:
1. Was bedeutet „gut"?
Woher will man wissen, dass Gott „gut“ ist? Wenn beide Begriffe synonym sind, bedeutet die Kategorie nichts mehr, oder zumindest nicht mehr das, was man gesellschaftlich unter gut versteht. Gott frisst dann gewissermaßen die Kategorie auf – und Sklaverei, Genozid, Sexsklaverei/Kindesmissbrauch sind plötzlich gut, wenn Gott es befiehlt. Derjenige, der eine Gebotsethik vertritt, muss diese Ausnahmen, die im biblischen Zeugnis klar enthalten sind, gut nennen. Wenn du ein Beispiel dafür hören willst, höre dir dieses Interview von Alex O´Conner mit William Lane Craig an. Er ist einer der bekanntesten Apologeten seiner Generation. Er verteidigt im Rahmen diese Theorie das drastische Beispiel des biblischen Gebotes zur Vernichtung der Kanaaniter. Nach der Gebotsethik ist diese Handlung gut und richtig, weil Gott sie befiehlt, ungeachtet der grausamen Konsequenzen für die betroffenen Menschen.
Wo fangen wir wirklich an?
Die Position, in Gott die Quelle objektiver Moral zu sehen, setzt voraus, dass ein Gott sich so offenbart hat, dass man seine Gebote einsehen kann. In der Realität ist das aber nicht so einfach: Ich gehe davon aus, dass der durchschnittliche Leser seine moralischen Überzeugungen nicht völlig aus der Bibel ableitet. Er bringt seinen moralischen Kompass schon mit an den Text heran: Das zeigt sich spätestens, wenn er seine Meinung zu folgenden „biblischen Positionen“ reflektiert:
- Was hält er davon, dass Frauen in ihrer Wertigkeit in den 10 Geboten im Buch Exodus direkt neben Vieh und Immobilien stehen(Ex 20,17)?
- Wie steht er zu Zwangsehen mit/Vergewaltigung von kriegsgefangenen Frauen (Deut 21,11)?
- Ist seiner Meinung nach Todesstrafe für…
- Arbeiten am Sabbat (Lev 20,13)
- das Fluchen von Kindern den Eltern gegenüber (Ex 21,17)
- den nicht erbrachten Beweis der Jungfräulichkeit einer Frau in der Hochzeitsnacht (Deut 22,20,21)
- …gut?
- Oder was sagt er zu den Kollektivstrafen, für Sodom und Gomorrha (Gen 19)/ Volk Ägypten (Ex 6-11)/ Israel (u. A. 2 Sam 21,1)?
Ich könnte noch zahlreiche andere Beispiele anbringen, aber du merkst, worauf ich hinauswill: Wenn man vertreten möchte, dass das alles falsch ist, dann vertritt man keine biblische Ethik. Und wenn man in der heutigen Gesellschaft nach biblischen Maßstäben leben würde, würde man ins Gefängnis kommen.
Vielleicht denkst du jetzt, man könne ja eine neutestamentliche Ethik vertreten, aber Jesus kam nicht, um das Gebot zu aufzuheben (Mt 5,17-18). Wenn man dennoch behaupten möchte, es käme auf die Werte an, die Jesus vorgelebt hat, ist man wieder ziemlich weit von einer objektiven Moralvorstellung entfernt – denn diese Werte wurden und werden in die unterschiedlichsten Richtungen ausgelegt – beinahe subjektiv, könnte man behaupten! Es scheint nämlich so, als würden die christlichen Vorstellungen von Moral sich auch weiterentwickeln.
Jeder, der behauptet, den Geboten Gottes zu folgen, folgt seiner kulturell geprägten Interpretation der Gebote Gottes. Mit „Ich mache das, was Gott sagt“ kommt man nur weiter, wenn man weiß, was Gott sagt und meint. Wenn man für sein Verständnis von Ethik einen Gott voraussetzt, ist man damit noch lange nicht am Ziel angekommen. Denn darauf aufbauend muss man trotzdem noch Entscheidungen treffen – spätestens, wenn die biblische Position nicht so klar und eindeutig ist, wie man es für eine gut begründete Einschätzung bräuchte.
Utilitaristische Alternative
Dennoch kann ich Christen nicht vorwerfen, einen Gott für ihre Position vorauszusetzen. Genau genommen, kann ich christliche Moral nicht kritisieren, wenn ich nicht von einer objektiven Moralvorstellung ausgehe, anhand derer ich dies tun könnte. Deshalb muss jede Kritik entweder eine innere Kritik sein (Gott an seinen eigenen Maßstäben messen) oder ich muss meinen Maßstab offenlegen. An dieser Stelle entscheide ich mich für letzteres.
Unterschiedliche Axiome
Dazu eine Vorbemerkung. Alle Thesen, die Menschen äußern, setzen andere Thesen voraus. Wenn man lange genug „warum“ fragt, landet man bei Thesen, die unbegründet angenommen werden müssen. Diese unbegründeten Vorannahmen nennen sich Axiome. In der christlichen Kausalkette der ethischen Begründungen ist Gottes Gebot und damit Gott selbst ein solches Axiom. Auch ich muss für meine ethischen Überzeugungen Vorannahmen treffen. Und über die kann man sich natürlich streiten.
Utilitarismus
Ich setzte voraus, dass Wohlergehen und Glück fördernswert sind. Somit ist „gut“ alles, was Wohlergehen fördert und „schlecht“ alles, was es verhindert oder ihm entgegenwirkt.
Der zweite Teil ist, dass ich Leid für mich und andere vermeiden und lindern möchte. „Gut“ ist also, was Leid lindert oder dafür sorgt, dass keines entsteht, und „schlecht“ ist, was anderen schadet oder Leid untätig duldet.
Mit diesen Axiomen ist der Utilitarismus gerade ein schlüssiges System für mich. Diese ethische Theorie besagt, dass die Richtigkeit einer Handlung durch ihr Ergebnis bestimmt wird, also durch das Maß an Glück oder Wohlergehen, das sie hervorbringt. Als moralische Handlungen gelten also diejenigen, die das größte Glück für die größte Anzahl von Menschen erzeugen. Diese Herangehensweise bietet einen rationalen und ergebnisorientierten Maßstab, der auf nachvollziehbaren und messbaren Konsequenzen basiert.
Wie jede andere ethische Theorie kommt diese auch an ihre Grenzen, wenn man über Ausnahmefälle wie beispielsweise über das Trolley-Problem philosophiert. Aber für meinen alltäglichen Umgang mit Menschen ist es erstmal ein hilfreicher Maßstab. Ich will das Wohlergehen meiner Mitmenschen fördern und ihnen keinen Schaden zufügen.
Das Coole an dem Modell ist, dass es keine Transzendenz voraussetzt: Das heißt, dass es auf der einsehbaren Wirklichkeit aufgebaut ist, die alle Menschen vereint. Außerdem ist es insofern anpassungsfähig, als es sich der Vorläufigkeit der aktuellen Erkenntnisse bewusst ist. Es unterliegt der empirischen Wirklichkeit und korrigiert sich selbst. Auf der Ebene kann ein rationaler Diskurs über Ethik und Moral stattfinden.
Die fehlende Diskursebene - Problem beider Seiten
Genau diese Ebene fällt weg, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dessen Moral vorrangig auf der Bibel basiert. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer sehr von mir geschätzten Freundin. An einer Stelle im Gespräch sagte sie, dass sie das Patriarchat eigentlich nicht so schlecht fände. In dem Moment war ich neugierig: Ich fragte sie nach den Gründen für diese Aussage. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber ich war einfach gespannt, welche Argumente für die Vorteilhaftigkeit dieser Art der Gesellschaft sie mir nennen würde. Sie, um meinen Dekonstruktionsprozess wissend, sagte: „Ich glaube, wir müssen keine theologische Diskussion anfangen.“ Etwas enttäuscht, sagte ich: „Ach so.“ Dann ging das Gespräch weiter, aber der Moment hat mich nicht mehr losgelassen.
Irgendwie hatte ich Gründe erwartet, über die man hätte diskutieren können. In dem Moment ist mir schmerzlich klargeworden: Mit jemanden, der seine Ethik in seiner Interpretation eines kulturell imprägnierten religiösen Text von vor Jahrtausenden begründet, habe ich im ethischen Diskurs keinen gemeinsamen Nenner. Wir gehen mit so unterschiedlichen Vorannahmen an ethische Themen heran, dass die Meinung und Begründung gegenseitig nur am Ziel vorbeischießen können.
Denn kein Argument, das die schädlichen innerweltlichen Folgen einer „biblischen“ Position darstellt, kann gegen die biblische Position ankommen. Ich kann noch so laut sagen, dass homosexuelle Menschen unter der biblischen Position leiden, oder dass es der Entfaltung von Frauen im Weg steht, sich unterzuordnen usw. Die empirische Realität wird immer von dem spezifischen Verständnis der Bibel übertrumpft werden.
Gleichzeitig kann mir jemand den ganzen Tag lang erzählen, etwas sei schlecht, weil Gott es so sagt. Wenn mir keine innerweltlichen Belege dafür gezeigt werden, wird das Argument in mir nichts auslösen.
Bibel vs. Koran
Wie unplausibel die Begründung mit der Bibel aus der nicht-christlichen Perspektive klingt, wird vielleicht nachvollziehbar, wenn man einfach mal kurz das heilige Buch auswechselt: Folgende Beispielsituation [die natürlich Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland nicht eintreffen wird]:
Ein Muslim, der bereits 3 Frauen hat, will jetzt zusätzlich noch ein 12-jähriges Mädchen heiraten – der Koran erlaubt es ihm schließlich (Sure 4,3; vgl. Sure 65,4). Wenn man jetzt ethisch diskutieren wollen würde, wo könnte man ansetzen?
Das einzige, worüber ein Christ, der die Gebotsethik vertritt, mit ihm diskutieren könnte, wäre, welche religiöse Schrift nun wirklich von Gott ist. Die Position an sich müsste dieser Christ stehenlassen, wenn er logisch konsequent sein wollte. Sonst würde er die Special Pleading Fallacy begehen: Wenn er auf utilitaristischer Ebene für die Frauen eintreten würde und erwarten würde, dass der Muslim sich davon überzeugen ließe, müssten diese Argumente auch ziehen, wenn ihn jemand z. B. über die Suizidrate von Transpersonen aufklärt, die in ihrem Umfeld abgelehnt werden.
Ethik ist beängstigend
Wenn immer jemand behauptet, Geboten Gottes zu folgen, entzieht er sich jeglichem rationalen Diskurs über dieses Gebot. Wenn jemand jedoch Gottes Gebote an den eigenen Vorstellungen und Intuitionen misst, ist damit Ethik von Gott losgelöst – und das ist durchaus beängstigend. Aber ich denke, Ethik wird immer beängstigend, wenn man sich bewusstmacht, welche Verantwortung in ethischen Entscheidungen integriert ist.
Trotz der Schwierigkeiten, die mit einer in Gott begründeter Ethik mit sich bringt, muss ich eingestehen, dass ich es toll fände, wenn es eine höhere Macht gäbe, die objektives Falsch und Richtig begründen würde. Klar hätte ich gern einen objektiven Standard dafür, dass es absolut falsch ist, Menschen aus Spaß zu schaden. Ethik ist immer noch eines der Themen, das für mich am ehesten für einen Gott, oder zumindest einen Wunsch nach Gott spricht.
Aber ich muss auch zugeben, dass ich mich mittlerweile deutlich weniger lost fühle, was Ethik ohne Glauben anbelangt. Ich habe meine Werte immer noch. Ich bin immer noch jemand mit hohen ethischen Standards. Und sie sind nicht plötzlich zu hohlen ethischen Standards geworden. Stattdessen bin ich mittlerweile bemüht, wirkliche Begründungen für meine Positionen zu entwickeln. Denn während es in meinem Glauben viel darum ging, was ich denken oder vertreten soll, geht es im Dekonstruktionsprozess für mich eher darum, wie und warum ich zu Urteilen komme.
Komplizierte Ungewissheit
Ethik ist deutlich komplizierter als mir lieb ist. Dieses Unbehagen wird man aber nicht durch Problem- und Verantwortungsverschiebung los, indem man einen Gott als Begründung zwischenschaltet. Wenn meine Begründung für eine ethische Position „Weil Gott das sagt“ ist, ist das im Grunde genommen nur ein Autoritätsargument. Das macht es noch lange nicht zwingend ungültig – Solange man der Autorität vertraut, kann es eine gute Begründung sein. Um diesen Vertrauensschritt zu machen, braucht es eine Entscheidung. Man könnte sogar behaupten, es sei eine moralische Entscheidung.
Aber wenn die Quelle, in der diese Autorität seinen Standard für Moral offenbart hat, ein Buch ist, in dem genau beschrieben wird, wie man Sklaven kauft und in welchem Maße es angebracht ist, sie zu schlagen, aber kein Wort daran verschwendet wird, dass Sex einvernehmlich stattfinden sollte, vertraue ich dieser Autorität nicht. Dann finde ich die Prioritäten dieses Gottes, wie sie dort offenlegt werden, beängstigender als meine subjektive Vorstellung von Moral. Dann bin ich froh, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der andere Prioritäten gelten.
Habe ich dafür gute Gründe? Kann ich überhaupt etwas Derartiges behaupten? Nicht objektiv. Nur, wenn ich „gut“ und „schlecht“ in Verhältnisbestimmungen erläutere. Ich kann diesen Gott und sein Wort nicht objektiv schlecht nennen. Alles, was ich tun kann, ist zu sagen, dass etwas empirisch betrachtet schlecht oder gut für das Erreichen eines bestimmten Ziels ist. Damit ist meine Ethik auch nicht besser oder schlechter als die eines anderen – objektiv betrachtet. Und sie baut auch auf Vorannahmen auf.
So ist die Frustration im ethischen Diskurs mit anderen wahrscheinlich beidseitiger Natur. Ich habe keine Antwort auf die Frage, wie man damit umgeht. Aus meiner Perspektive ist der Utilitarismus deutlich anschlussfähiger, da die Axiome innerhalb einer wahrnehmbaren Realität angenommen werden können. Aber wenn man an eine geistliche Realität glaubt, kann man mir durchaus Kurzsichtigkeit vorwerfen, wenn ich nur die innerweltlichen Konsequenzen berücksichtige. Vielleicht ist das berechtigt. Vielleicht irre ich mich. Das Thema ist für mich noch lange nicht zu Ende gedacht.
[Kurzer Hinweis zum Schluss: Das ist kein Entweder oder, es gibt viele andere moralische Theorien, die ihrerseits bedacht werden sollten. Das sind nur die beiden, die mir in letzter Zeit am nächsten standen.] Wenn du Gedanken zu dem Thema teilen möchtest, schreibe sie mir gern in die Kommentare!
Du hast einen (Rechtschreib-)Fehler gefunden? Dann kannst du ihn mir ganz einfach mitteilen, indem du die Textstelle markierst und Strg und Enter drückst. Dann öffnet sich ein Kommentar- und Bestätigungsfeld, damit du im Falle eines inhaltlichen Fehlers erklären kannst, was du meinst. Vielen Dank schonmal!