Inhalt
ToggleIn Short
-
Die menschliche Tendenz, den negativen Aspekten mehr Beachtung zu schenken als den positiven, schlägt sich auch in (meinem) Dekonstruktions-Content nieder.
-
Das ist weder fair noch repräsentativ - deshalb hier 7 Dinge, die ich am Christentum schätze.
-
Das ist natürlich keine vollständige Liste :)
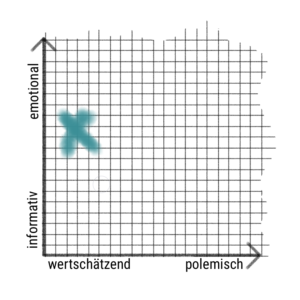
Es gibt Phasen eines Dekonstruktionsprozesses, in denen man vieles ziemlich blöd findet. Diese Phasen haben durchaus ihre Berechtigung. Außerdem ist es häufig so, dass man eher defizitär auf Situationen schaut und deswegen viel mehr über das redet, was einen stört. Das fängt schon im Bereich der Wahrnehmung an:
Stell dir vor, du stößt dir deinen großen Zeh und er tut für eine Weile weh. Wie oft wirst du an dem Tag an deinen großen Zeh denken? Wie oft im Vergleich dazu wirst du an deine anderen 9 Zehen denken, die nicht schmerzen? An ersteren wahrscheinlich viel, an letztere vielleicht überhaupt nicht. Und an einem Tag eine Woche später, wenn du schon wieder vergessen hast, dass der Zeh überhaupt wehgetan hatte, wirst du wahrscheinlich in keinem Moment innehalten und zufrieden denken: „Wie nice, meine Zehen funktionieren wie sie sollen und tun nicht weh!“
Das ganze nennt sich Negativitätseffekt und lässt sich auch auf psychische Prozesse übertragen: Negative Erlebnisse, Gedanken oder Emotionen prägen uns mehr als positive oder neutrale Erlebnisse, Gedanken oder Emotionen gleicher Intensität. Das Negative bleibt uns länger in Erinnerung, löst mehr in uns aus und ist rundum präsenter. Das ist gewissermaßen auch sinnvoll – immerhin sind das die Dinge, in deren Veränderung und Verbesserung wir unsere Energie stecken sollten.
Aber dennoch ist es gut, zwischendurch innezuhalten und sich den Dingen zu widmen, die positiv sind. Das hier sind die Aspekte des Christentums, die für mich besonders herausstechen. Die Reihenfolge ist nicht ausschlaggebend.
Die große Story
Menschen leben in Narrativen. Nicht nur in der persönlichen Aneinanderreihung von Lebensereignissen, die wir als eine einheitliche Biografie verstehen: Auch in den Geschichten unserer Familien, unserer Städte und unserer Heimatländer finden wir Identität. Religionen bieten das noch auf einer tieferen Ebene. Denn besonders im christlichen Glauben geht um eine viel größere Geschichte: Sie hört nicht da auf, wo die überlieferten Erzählungen über die Urgroßeltern erschöpft sind. Sie ist nicht durch Städte- und Landesgrenzen beschränkt. Sie umfasst alle Zeit, allen Raum, alles Leben. Es ist total wertvoll, sich in solch ein Narrativ eingebettet zu finden – vor allem, da der Fort- und Ausgang dieser Geschichte nicht von uns abhängt: Wir als einzelne Menschen können es nicht versauen. Aber auch unsere Familien, Städte und Länder können das nicht. Diese Geschichte steht fest und ist von uns unabhängig, auch wenn wir in sie integriert sind. Darin gibt es Sicherheit, Sinn und Bedeutung.
Vergebung
Mittelpunkt dieser Weltgeschichte ist ein Ereignis, in dessen Zentrum wiederum die Versöhnung dieser Welt mit ihrem Schöpfer und Erhalter steht. Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort lebt, bekommt man das als Evangelium vermittelt. Und damit gibt es eine Art der Freiheit, die es sonst nicht gibt. Mit der Zusage, dass jemand anderes für deine Unzulänglichkeiten aufkommt, dich im tiefsten Innern sieht und annimmt, kommt eine tiefe Erleichterung. Klar müssen Schuldgefühle differenziert betrachtet werden: Es gibt definitiv zu feine Gewissen, unrealistische Maßstäbe, sogar krankhafte Schuldverzerrungen.
Aber es gibt auch echte Schuld: Schuld, die nicht beglichen werden kann; ein Gewissen, das plagt. Von dieser Schuld kann man sich nicht selbst befreien. Die Vergebung der höchsten vorstellbaren Macht kann sich total befreiend anfühlen und Frieden bringen – vor allem, weil es nicht um den Menschen selbst geht. Es handelt sich nicht um eine Leistung, sondern um die Zurechnung einer bereits erbrachten Leistung dieses Gottes selbst.
Demut
Damit geht (im besten Fall) ein Menschenbild einher, das den Menschen realistisch betrachtet: Zum einen ist da die Gottesebenbildlichkeit, die den unzerstörbaren Wert eines Menschen anerkennt; zum anderen ist da aber auch die menschliche Fehlbarkeit, die nicht verschwiegen wird. Dieses Bild, das den Menschen in seinem Sein und Tun ganzheitlich sieht, kann eine Demut hervorbringen – keine falsche Bescheidenheit, sondern das Wissen um Wert und Wirklichkeit.
Die Umkehrung der Werte: Klein ist groß!?
Die Werte, die sich unter „christlicher Nächstenliebe“ zusammenfassen lassen, sind zweifelsohne gesellschaftstransformierend – im positivsten Sinne. Jesu Gleichnisse und Taten kehren Erwartungen um: Er hebt den Schwachen über den Starken und stellt den Armen über den Reichen. Er kritisiert die Elite und macht den Abschaum der Gesellschaft zu den Hauptdarstellern der Geschichte. Alles, was sich in dem Vers „Die Letzten werden die Ersten sein“ (Matthäus 20,16) zusammengefasst findet – all das hat das Potenzial, Menschen in ihrem Weltbild, ihrem Streben und ihrem Blick auf sich selbst und andere positiv zu prägen.
Das tiefe Nachdenken über Literatur
Christen sind tief verankert in ihrer Bibel. Bestenfalls werden jeden Sonntag verschiedene Texte gelesen, über sie meditiert und gepredigt. Das konfrontiert Menschen in Gemeinden regelmäßig mit Konzepten, Gedanken und Weisheiten anderer Kulturen und Zeiten. Das erweitert den Horizont und man dadurch vielleicht sogar neugieriger und empathischer anderen Kulturen und Sitten gegenüber wird. [Es gibt Studien, die eine Korrelation zwischen aktivem christlichen Glauben und Empathie feststellen, auch, wenn nicht nur Selbst-, sondern auch Fremdeinschätzung integriert wurde. Die Verbindung mit der Bibel ist aber nur ein Gedanke, den ich als einen Erklärungsansatz vorschlage.]
Wenn man sogar selbst Bibel liest, schafft das (besonders in einer weniger lesefreudigen Generation) ein verbessertes Leseverständnis und verstärkt die Horizont erweiternde Wirkung von Bibeltexten, die schon durch Gottesdienste gegeben ist.
Selbstreflexion...
...im Gemeindekontext
Christen sind es gewohnt, regelmäßig mit Stille, unbequemen Predigtthemen und persönlichen Fragen konfrontiert zu werden. Aber auch in der Gemeinschaft in der Gemeinde schleifen sich Menschen aneinander [das ist nebenbei bemerkt auch biblische Bildsprache, die menschliches Denken prägt]. Gerade in einer eher individualistischen Gesellschaft, in der sich viele Menschen eher nicht in ihr Privatleben hineinsprechen lassen, kann eine Gemeinschaft, in der Menschen mit sich selbst konfrontiert werden, das Beste in diesen Menschen hervorbringen.
... im persönlichen Gebet
Es ist wertvoll, regelmäßig innezuhalten und sich zu fragen, wo man gerade ist: Was sind die eigenen Baustellen, blinden Flecken, Ziele und Hoffnungen? Wenn man sich wirklich auf einen Gottesdienst einlässt, kann er zum Raum für diese Art der Reflexion werden. Damit entsteht ein natürliches Umfeld, in dem Achtsamkeit geübt werden kann. Besonders kondensiert finden sich diese Eigenschaften auch im persönlichen Gebet. Gebet ist eine tiefe, ehrliche Form der Selbstreflexion – vielleicht die Ehrlichste, die man erleben kann.
Denn in dem Moment des Gebets, wenn man die Woche, das Gespräch von vorhin oder die eigenen Gedanken vor Gott ausbreitet, gibt es weder Grund noch Möglichkeit dazu, die Tatsachen verschleiert oder beschönigt darzustellen. Vor Gott kann man brutal ehrlich sein. Diese Gebetszeiten können dazu beitragen, den Blick auf das eigene Leben zu schärfen. Eine gute Beziehung zu einer übernatürlichen Macht kann auch gegen Einsamkeit helfen und sich so positiv auf die (mentale) Gesundheit auswirken.
Gemeinschaft
Gemeinde
Ebenso ist es statistisch belegt, dass sich Glaubensgemeinschaften positiv auf das Wohlergehen Einzelner auswirken kann: Ein Großteil dieser positiven Effekte hängt mit der sozialen Komponente zusammen. Menschen sind Gemeinschaftswesen. Eine Gemeinde ist mehr als „nur“ eine Familie, eine Freundesgruppe oder auch ein Verein. Denn hier treffen bestenfalls verschiedene Generationen und Gesellschaftsschichten aufeinander. Das wiederum kann auch Perspektiven eröffnen und Empathie fördern.
Diese Menschen versammeln sich um das jeweils Wichtigste in ihrem Leben: Der Glaube verknüpft die einzelnen miteinander. So tun es auch die Rituale, Lieder, Gebetsgemeinschaften, Kaffeetrinken u. Ä. Mit der Gemeinde haben die einzelnen ein soziales Netz, in dem sie sich angenommen fühlen und einander unterstützen. Das kann für Selbstwert und das allgemeine Wohlbefinden sehr förderlich sein.
Tiefe Beziehungen
Nicht nur die große, sondern auch die kleine Gemeinschaft in Form von Hauskreisen, Zweierschaften, Mentoring und vor allem tiefen Freundschaften sind ein großer positiver Bestandteil christlichen Glaubens. Diese Freundschaften können leichter tief werden: Schon allein aufgrund der gemeinsamen Erfahrungen, die Glaubensleben, Gemeindeangelegenheiten, oder emotionale Momente im Gottesdienst betreffen, ist die Hürde, über tiefe Themen zu sprechen, niedriger. Außerdem sieht man sich regelmäßig in Gottesdiensten oder anderen Versammlungen, was das Aufrechterhalten eine Freundschaft unterstützen kann. Was das betrifft, sind Gemeinden (bestenfalls) auch Orte, welche die Gesprächsfähigkeit der Menschen fördern und damit auch ihre Beziehungsfähigkeit positiv beeinflussen können.
Gastfreundschaft
Die Bibelgeschichten, die die Menschen prägen, spiegeln auch die Werte und Prioritäten einer anderen Zeit wider. Ein großer Wert dieser Zeit(en) und Kultur(en) war die Gastfreundschaft. Dieser Wert prägt somit auch heute christliche Gemeinschaften. Damit ist ein wichtiges Fundament dafür gelegt, dass Leben geteilt werden kann.
Wenn man Menschen in ihrem privaten Umfeld erlebt, kann das die Beziehung nochmal vertiefen – und es kann eine Ehrlichkeit schaffen, die sonst nicht entstanden wäre, besonders, wenn man länger als nur für einen Kaffee bleibt.
Der Blick hinter die Kulissen zeigt, dass es in jedem Haushalt mal drunter und drüber geht.
Er zeigt, wie unterschiedlich sich ein Leben positiv gestalten lässt.
Er zeigt, dass wir alle nur Menschen sind.
So fördert Gastfreundschaft zusätzlich zu den vertieften Beziehungen auch eine realistische Perspektive auf die Menschen und damit auch wieder Empathievermögen.
Soviel für jetzt – wie gesagt, keine vollständige Liste. Was schätzt du am Christentum am meisten? Wie wirken sich unterschiedliche Phasen deines Prozesses auf die Wahrnehmung dieser positiven Aspekte aus? Schreib es mir gern in die Kommentare!
Du hast einen (Rechtschreib-)Fehler gefunden? Dann kannst du ihn mir ganz einfach mitteilen, indem du die Textstelle markierst und Strg und Enter drückst. Dann öffnet sich ein Kommentar- und Bestätigungsfeld, damit du im Falle eines inhaltlichen Fehlers erklären kannst, was du meinst. Vielen Dank schonmal!
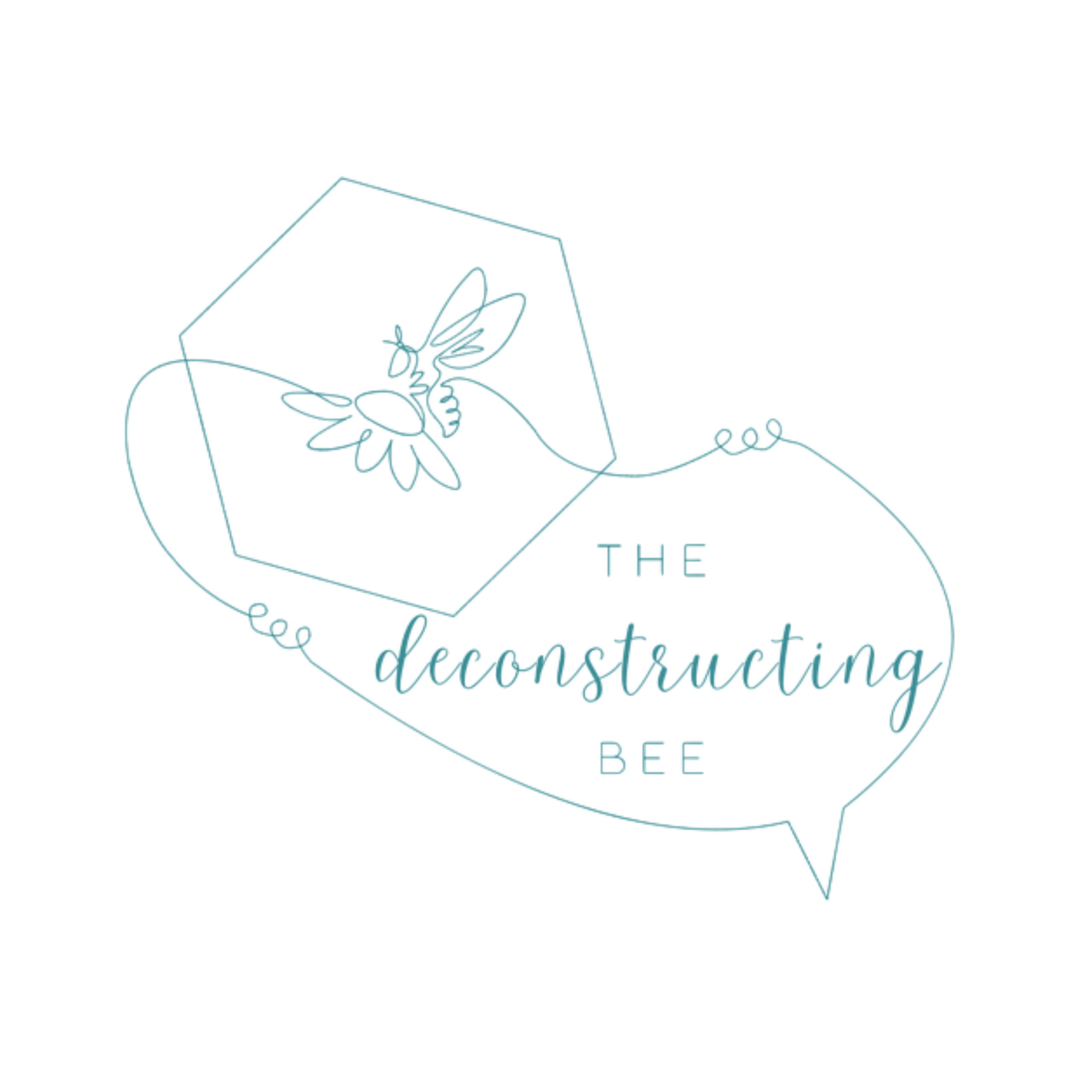



Ich schätze am Glauben an Jesus Christus, dass ich mich nicht allein fühle.
In Momenten der Not kann ich ein Stoßgebet aussprechen und in Momenten der Angst, stelle ich mir vor, dass Jesus Christus mich verteidigt gegen das, was mir Angst macht.
Mir hilft es zu wissen, dass der allmächtige, allgegenwärtige Gott für mich ist und ich zu Ihm beten kann, um in meinem Alltag und vor Allem in meinen Beziehungen unbeschwerter und glücklicher zu leben.
Hi Emelie, danke fürs Teilen! Schön, dass dich der Glaube so positiv trägt :)